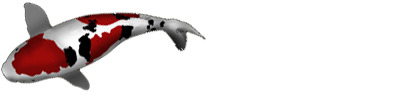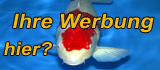Fortsetzung
(auf einem Smartphone ist die Anzeige der Tabellen ggf. schwierig
Hier Luftdruck- u. Korrekturwerte zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung in Prozent.
Die Druckangaben mmHG stammen von Werner H.Baur (s. Quellenangaben). Die Umrechnung auf QNH und QFE (in Prozent) kommen von mir.
Höhe mmHG Druck in hPa QFE QFF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 m 760 1013,25 100% aktueller Wert
100m 750 999,92 98,68%
200m 741 987,92 97,50%
300m 732 975,92 96,32%
400m 723 963,92 95,13%
500m 714 951,92 93,95%
600m 705 939,92 92,76%
700m 696 933,25 92,10%
800m 687 915,92 90,39%
900m 679 905,26 89,34%
1000m 671 894,59 88,28%
Sättigungswerte von Sauerstoff in Wasser bei verschiedenen Temperaturen und mittlerem Luftdruck. Bei 1013,25 hPa. auf Meereshöhe
(nach Werner H.Baur)
Temperatur mg/l Temperatur mg/l
0° 14,2 16° 9,6
1° 13,8 17° 9,4
2° 13,4 18° 9,2
3° 13,1 19° 9,0
4° 12,7 20° 8.8
5° 12,4 21° 8,7
6° 12,1 22° 8.5
7° 11,8 23° 8,4
8° 11,5 24° 8,2
9° 11,2 25° 8,1
10° 10,9 26° 8,0
11° 10,7 27° 7,9
12° 10,4 28° 7,7
13° 10,2 29° 7,6
14° 10,0 30° 7,5
15° 9,8
Ein Beispiel zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung.
Ort/ Tag: Innenhälterung Meßstetten 900m ü.M, 04.10.2010
Gegenwärtiger Luftdruck: 16:00 h = 1003 hPa (abnehmend)
Wassertemperatur : 16°C
Salzgehalt: 0,3%
Messung O²: 8,5mg/l
Erreiche ich mit diesem Sauerstoffgehalt mein angestrebtes Ziel, welches einer 100% igen Sättigung entsprechen soll?
Um eine fundierte Aussage treffen zu können, muss ich die örtlichen Verhältnisse berücksichtigen.
Nur die Umrechnung auf die prozentuale Sättigung ermöglicht mir einen differenzierten Vergleich der Werte.
Bei 16°C und in Meereshöhe beträgt der Sättigungswert lt. Tabelle 9,6 mg/l. Die Messung ergab einen Wert von ca. 8,5mg/l. Dies entspricht 88,5%.
Der auf 900 m Höhe reduzierte Luftdruck (QFE) beträgt 905,26 hPa, ausgehend von 1013,25 hPa (QNH). Dies entspricht 89,34%.
Der aktuelle Luftdruck in Meßstetten liegt mit 1003 hPa etwa 1% (10 hPa) unter dem mittleren Wert in der Standartatmosphäre ( QNH). Bezogen auf das QFE sind dies sind dann 88,44%.
Hier wird die Korrelation zwischen dem O²- Sättigungswert (88,5%) und dem tatsächlichen Luftdruck am Ort QFF (88,44%) deutlich. Die Abweichung ist gering.
Dat isso!
Die 8,5mg/l entsprechen demnach 100%.
Ich gönne mir hier einen Toleranzwert von +/- 2%, für geringe Messfehler, kleine Gewitter und einen veränderlichen Salzgehalt.
Link auf QNH Meßstetten
Datum Messung Temp. Sättigung lt. Sättig. QNH QFF QFF Abweichung
Tabelle in% in% von O² max
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.10. 8,5mg 16,5° 9,4mg 90,4% 1010 902,3 89% +1,4%
06.10. 8,6mg 16,4° 9,6mg 89,6% 1013 905,3 89,3% +0,3%
06.10.- 07.10. Und hier die normale Belüftung, d.h. ohne Reaktor, jedoch mit gleicher Luftmenge
07.10. 7,5mg 16,8 9,4mg 79,7 1021 913,3 90,1% -10,4%
Vorsicht Sauerstoff !
Lebewesen sind nicht an das Atmen von reinem Sauerstoff angepasst. In unnatürlich hohen Konzentrationen wirkt O² nämlich sehr aggressiv. Andere Stoffe (Gewebe, Körperzellen, auch Metalle, usw.) oxidieren, werden "verbrannt" und früher oder später auch zerstört. Die Schutzmechanismen der „Natur“ sind darauf nicht eingestellt.
Es ist bekannt, dass viele Fische in der Lage sind kurzzeitig hohe O²- Konzentrationen `wegzustecken`, d.h. sie `überleben` es. Das bedeutet aber nicht, dass sie daraus generell einen Nutzen ziehen.
„Der Sauerstoffgehalt des arteriellen Blutes erhöht sich bis zu einem gewissen Grad mit dem Anstieg des Sauerstoffpartialdruckes im umgebenden Atemwasser, ab etwa 80mm Hg bleibt er mit rund 8Vol.-% gleich.“ (Werner Steffens, 2008)
Bei einer O²-Übersättigung im Atemwasser sind die Fische gezwungen ihre Atemfrequenz und ihre Atemintensität zu reduzieren.
Nach Literaturangaben von W. Steffens, (1955) reduzieren zweisömmerige Karpfen ihre Atemfrequenz (Zahl der Maulöffnungen/Min.) auf 0,2 bis 0,3/min, wenn wie in diesem Beispiel eine O²- Übersättigung von 21,6mg/ bei 14° vorliegt.
Jetzt könnten wir meinen, dass durch die Verringerung der Atemfrequenz sich auch die allgemeine Situation der Fische weiter verbessert. Und genau das …. ist nicht richtig.
Die Aufgabe der Kiemen besteht eben nicht nur darin, für eine Sauerstoffanreicherung des Blutes zu sorgen. Bei jedem Atemzug geben sie auch Kohlensäure ab und sie übernehmen auch den größten Teil der Stickstoffexkretion (über 80%). Über die Atmung wird der Fisch seinen Stoffwechselabfall (vorwiegend Ammoniak) los. Dies funktioniert nur, wenn wir den Fischen optimale Umweltbedingungen bieten. Ihre Atemfrequenz muss stimmen. Dauerhafte Sauerstoff- Konzentrationen im Bereich des Sättigungswertes sind optimal. Eine O²- Übersättigung macht keinen Sinn.
Hier noch ein Zitat.
„Der Beginn des Resistenzbereiches bzw. das Ende des Toleranzbereiches ist bei den verschiedenen Arten sehr unterschiedlich und wird maßgeblich von der Höhe des Sauerstoffgehaltes beeinflusst, an den die Fische vorher gewöhnt waren. Akklimatisation an einen hohen Sauerstoffgehalt bedingt höhere Letalwerte.“ (W.Steffens, 1985)
Bei hohen Fischbestandsdichten können in Anlagen mit Sauerstoffbegasung hohe CO2 Konzentrationen im Kreislaufwasser entstehen. Ursache dafür ist häufig der geringe Gasaustausch mit der Atmosphäre(kleine, unbewegte Wasseroberfläche, ggf. Kahmhaut). Dann besteht die Gefahr, dass die Fische an einer respiratorischen Azidose erkranken.
Gewitter und Koisterben
Das Gewitter den atmosphärischen Luftdruck soweit absenken können, dass es zum auslösen/ausperlen des Sauerstoffs kommt, ist schlicht falsch. (Es sind nur 2 bis 3 Hektopascal Differenz.und ... Dat macht nix
Größere Luftdruckunterschiede, vor und nach dem Durchgang von Frontensystemen/Stürmen, sind auch keine Seltenheit, sondern an der Tagesordnung. Starke Niederschläge können den Sauerstoffgehalt im Wasser, wenige Zentimeter unter der Oberfläche, auch nur kurzzeitig mindern.
Wenn Fische nach einem Gewitter sterben, hat dies verschiedene andere Ursachen. Am wenig veränderten Luftdruck liegt es nicht. Ich habe diese Bewertung mal von einem Meteorologen vom Amt für Geoinformationswesen bestätigt bekommen.
Hier noch ein einfacher Rechner.
http://www.hbuehrer.ch/Rechner/O2Saett.html
Der reicht für Hobbyisten vollkommen aus.
Quellenangaben:
-Werner H.Baur, Gewässergüte bestimmen und beurteilen, Parey 1998
-Martin Sander, Aquarientechnik im Süß- und Seewasser, Ulmer 1998
-Untersuchungen an einem Blasensäulen-Abstromreaktor,Chem.-Ing.Tech.50(1978) Nr. 12
-Geoinformationsdienst der Bundeswehr (FAGeoInfoDBw 2-15-112) Oktober 09
-Kombinierte Satzkarpfen-Edelfischaufzucht in geschlossenen Kreislaufanlagen. Schriftenreihe der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtshaft
( Heft 13/2006)
- L. Dettmann (2000): CO2 Mangel in der Forellenproduktion. Ursachen, Auswirkungen und Möglichkeiten der Therapie
-L. Dettmann ( 2001): Atmung der Fische
-Leif L. Marking (1987): Gas Supersaturation in Fisheries: Causes, Concerns, and Cures
-Knut Schmidt-Nielsen (1999): Physiologie der Tiere
- Bernd Pelster (1993): Die Schwimmblase als hydrostatisches Organ