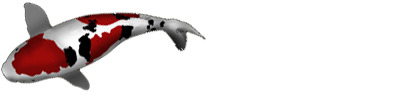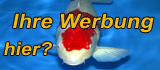Habe ich doch schon mal geschrieben ist das gelöscht worden ?
War im Zeitfenster des KHV Tests.
Kiemennekrose im zusammenspiel mit sehr starker bakterieller Befall würde ich vermuten.
Teste Phosphat das müste sehr hoch sein.
Teste Nitrat der wert müste auch extrem hoch sein.
Mach Wasserwechsel falls die Werte sehr hoch sind und korriegiere diése Werte damit.
Mindestens täglich 15 Prozent Wasserwechsel.
Pass auf den PH Wert mit den ganzen Auströmersteinen auf!
Lass deine Fische auch auf bakterieller Befall testen.
Tupferprobe oder bei den Labor bescheid sagen.
Vermutlich solten sich Aeromonas sobria und Pseudomonaden finden lassen.
Aeromonas sobria schleppen Dir z.B Frösche in den Teich und Pseudomonaden sind ein "Hygieneproblem"!
Ich kopiere dir nochmal einige Berichte über Kiemenfäule rein.
Kiemennekrose
Im Kiemengewebe der Fische befinden sich verschiedene Zelltypen mit recht unterschiedlichen Aufgaben. Neben Abwehr- und Schleimzellen finden sich auch so genannte Chloridzellen, die für die Ein- und Ausschleusung von Salzen bedeutsam sind. Insbesondere bei Fischen, die zwischen Süß- und Salzwasser wandern, müssen Anpassungen im Salzhaushalt durch Vermehrung der Chloridzellen stattfinden, damit sie diese Umweltveränderung überleben können.
Die Kiemen, sichtbar sind diese als rote Lamellen unter den Kiemendeckeln, gehören zu den bedeutendsten Fischorganen. Wichtigste Aufgabe ist natürlich die Atmung, aber auch die Aufrechterhaltung des Salz- und Wasserhaushaltes sowie die Ausscheidung von Endprodukten des Stickstoffstoffwechsels wie Ammoniak und Harnstoff. Somit entspricht die Funktion der Kiemen nicht nur der menschlichen Lungen-, sondern auch der Nierenfunktion.
Die Schleimbildung führt zur Behinderung des Gasaustausches.
Das Gewebe ist teilweise abgestorben.
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, weisen die Kiemen eine vergrößerte Oberfläche auf, diese haben ausgebreitet mindestens die gleiche Fläche wie die gesamte Hautoberfläche des Fisches. Diese Oberflächenvergrößerung wird erreicht durch die Ausbildung von Primärlamellen (auch mit bloßem Auge erkennbar) und mikroskopisch kleinen Sekundärlamellen.
Zum Gasaustausch (Atmung) sind die Sekundärlamellen mit einer hauchdünnen Zelllage (Epithel) ausgestattet, die das Körperinnere von der Umwelt trennt. Diese sind ca. 0,5 µm dick. Der spezielle Aufbau der Kiemen macht sie aber auch sehr empfindlich. Die Kiemen sind allen Stoffen, auch giftigen, im Wasser direkt ausgesetzt. Ebenso Krankheitserreger, die die Kiemen selber befallen oder an dieser Stelle in den Körper eindringen können, haben leicht Zugang.
Viele Außenparasiten bevorzugen die Kiemen als Standort, weil sie hier mit sauerstoffreichem Wasser und Nahrung versorgt werden und in der Kiemenhöhle geschützt leben können. Durch den einfachen Bau der Kiemen hat dieses Organ nur begrenzte Möglichkeiten, auf schädliche Einflüsse zu reagieren.
Unabhängig von der Ursache kommt es meist zuerst zu einer vermehrten Schleimbildung, gefolgt von einer Verdickung des Kiemenepithels durch Vermehrung der Zellen. Dies führt dann zu einer Behinderung des Gasaustausches, welchem oft die Bildung einer klebrigen Schicht auf der Kiemenoberfläche folgt, was wiederum die Ansiedlung von Bakterien begünstigt. Weitergehende Schädigungen der Kiemen können sich äußern in Thrombosenbildung in den Kapillaren, Verwachsungen zwischen den Sekundär- und Primärlamellen, Wasseransammlung im Gewebe, Ablösung des Epithels bis hin zum völligen Absterben des Gewebes (Kiemennekrose).
Bei diesen Vorgängen werden die lebenswichtigen Funktionen der Kiemen beeinträchtigt oder kommen ganz zum Erliegen, das Geschehen kann tödlich enden. Schädigungen der Kiemen haben zwar häufig äußere Ursachen oder werden durch kiemenspezifische Krankheitserreger wie Parasiten, Pilze oder Bakterien verursacht, jedoch können sich auch innere Schädigungen auf den Kiemen niederschlagen. Hier kommen bestimmte Nährstoffmängel, Stoffwechselstörungen sowie Allgemeininfektionen mit Bakterien oder Viren in Betracht. Ein Beispiel ist dabei die KHV- (Koi-Herpes-Virus) Infektion, die bei Speisekarpfen zu massiven Verlusten in Verbindung mit Kiemenveränderungen führt.
Oder aber.........
Kiemenfäule
Eine durch zwei Vertreter der Gattung Branchiomyces hervorgerufene Pilzerkrankung ist die Kiemenfäule. Der Pilz tritt zunächst innerhalb der Kiemenepithelien auf und bricht bei weiterem Wachstum nach außen durch. Kiemenfäule kann besonders im Sommer bei hohen Wassertemperaturen in stark eutrophierten Teichen mit dichtem Fischbesatz zu großen Verlusten führen.
Bei erkrankten Fischen beobachtet man folgende Symptome: Luftschnappen, Kiemenschwellung und Blutergüsse an den Kiemen, äußerlich sichtbare Verpilzung und gelblich bis braune Verfärbung des Kiemengewebes. Im Endstadium sind die Kiemen dann weitgehend zerstört. Bei genügend starker Vergrößerung unter dem Mikroskop sind in abgeschnittenem Kiemengewebe die Pilzschläuche und Sporen gut auszumachen.
_________________
Kiemennekrose
Die auch als Brachionecrosis bezeichnete Krankheit ist stark umweltabhängig. Sie tritt vorwiegend in Teichen mit hohem PH-Wert (9 und höher) auf (Algenblüte). Bei steigeden ph-Werten ist der Fisch nicht mehr in der Lage, den im Blut gebideten Ammoniak über die Kiemen an das Wasser abzugeben. Das heißt der Ammoniakgehalt des Blutes steigt an, die Kiemen werden zerstört. Nun ist der Fisch nicht mehr in der Lage, Sauerstoff aufzunehmen. Erkrankte Fische sondern sich ab, atmen schwer und suchen sich eine Stelle im Teich mit erhöhter Sauerstoffzufuhr.
Die Fütterung muß umgehend eingestellt werden, um das Wasser nicht noch mehr zu belasten. Jeden Tag sollte ca. ein Drittel des Teichwassers durch Frischwasser ersetzt werden. Es muß für eine gute Filtrierung gesorgt werden.
-------------------------------------------------------------------------------
Kiemennekrose
Eine Kiemennekrose entsteht aus einer nicht auskurierten Kiemenschwellung. Die Sekundärlamellen sterben ab, bis nur noch die nackten Primärlamellen übrig bleiben. Die dabei auftretende weißliche Verfärbung wird im Endstadium schwarz. Gasaustausch, Ammoniakabgabe oder Osmoregulation sind nicht mehr möglich, und das bedeutet den Tod des Koi.
Behandlung: Im Anfangsstadium lässt sich die Kiemennekrose durch abwechselnde Gaben von Phosphorus D6 und Tartarus emeticus D6 mehrmals täglich aufhalten. Bei Gabe über das Teichwasser 15 Tabletten pro 1000 l Wasser.
Infektiöse Kiemennekrose
Die Symptome sind nahezu identisch mit denen der nicht infektiösen Kiemennekrose. Außerdem kann Flossenfäule beobachtet werden, Ektoparasiten und Mykosen sind wegen der massiven Schleimbildung nur als Begleiterscheinung zu betrachten. Als Erreger werden unter anderem Myxobakterien vermutet und zwar ein extrem hoher Befall mit diesen Keimen (latenter Befall ist normal). Auch ein spezielles Koi-Herpes-Virus konnte nachgewiesen werden. 1997 wurde diese Erkrankung zum ersten Mal beobachtet. Meistens gehen ihrem Auftreten Neuzukäufe voraus. Beifische (etwa Goldfische) erkranken nicht. Bei den Koi kann es zu vollständigem Bestandsverlust kommen. Die Erkrankung tritt meist in den Monaten von Juni bis September auf. Eine schulmedizinische Behandlung ist nicht bekannt. Erkrankte Koi müssen sofort isoliert werden.
Behandlung: Die Prognose ist schlecht. Eine Behandlung kann folgendermaßen versucht werden: Maßnahmen wie bei der Kiemennekrose, jedoch zusätzlich apo-Infekt, 5 ml je 1000 l Wasser täglich. Empfehlenswert ist außerdem Ferrum phosphoricum D12 nach Schüßler von Iso, 6 Tabletten auf 500 l Wasser täglich.
Das Algenwachstum im Winter oder besser gesagt im Frühjahr bei niedrigen Temperaturen kommt von den Nährstoffen im Wasser und dem Licht das die Algen jetzt erhalten. Denn zu dieser Zeit ist das Wasser sehr klar auch bei Teichen die sonst unter Schwebealgen leiden. Es sind aber eher Schleimalgen die keine so feste Konsistenz wie die Fadenalgen haben. Sie lassen sich auch bis auf einen Rest leicht ablösen und zerfallen schnell im Wasser.
Kiemennekrose kann durch Selbstvergiftung der Fische entstehen. Über die Kiemen geben die Fische Stickstoff als Ammoniak an das Wasser ab. Ist die Konzentration zu hoch können die Fische sich damit selbst vergiften. Da im Winter der Filter nicht funktioniert ist die Gefahr gegeben, aber es gibt auch noch viele zusätzliche Faktoren die dazubeitragen das soetwas passieren kann.
Im Grunde kann man das als Vergiftung betrachten. Faktoren die auch berücksichtigt werden sollten sind:
Überbesatz,
zu wenig WW,
zu viel Futter,
verwesende Tiere (Mäuse, Kröten, Fische usw.),
zu keiner oder nicht funktionierender Filter,
zu viel Schlamm am Boden.
Diese Aufzählung ist sicher nicht vollständig. Wenn der PH-Wert hoch ist wird aus dem ungefährlicheren Ammonium Ammoniak.
Hier mal eine Tabelle dazu.
http://aquaristik-hilfe.de/chemie02.htm
D. Untergasser schreibt in seinem Buch Krankheiten der Aquarienfische, das Verhalten der Fische bei Ammoniakvergiftung.
Sie schwimmen normal, atmen jedoch heftig. Sie stehen unter der Wasseroberfläche und atmen unregelmäßig und schnell.
Sie bewegen sich immer weniger, werden apathisch und sterben in voller Farbe.
Ihre Kiemen sind lila verfärbt." Bei Beobachtung der Symptome sollten sofort Ammonium und pH gemessen werden und im Bedarfsfall der pH abgesenkt werden.
Starke CO2 austreibende Luftsprudelsteine erhöhen den PH -Wert ebenfalls. Gegebenfalls die Luftzufuhr reduzieren und einen SK für die Sauerstofferhöhung anschließen.
Das Problem entsteht nicht nur im Winter, auch bei hohen Temperaturen im Sommer ist das sehr gefährlich wenn dann noch von den oben genannten Faktoren welche dazu kommen.
Wechsel den Tierart gegen einen brauchbaren!