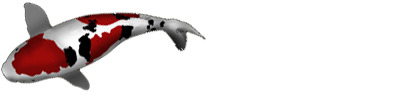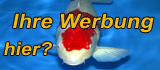Kuckuck Bernd
Mitglied
Hallo Jogi,
sehr aussagekräftig :shock: :?
sehr aussagekräftig :shock: :?


peter weber schrieb:... sie belegen, dass Milchsäurebakkis einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Fische, eine bessere Abheilung von Wunden, sowie einen positiven Einfluss auf Algenvernichtng haben. :roll:
OlympiaKoi schrieb:peter weber schrieb:... sie belegen, dass Milchsäurebakkis einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Fische, eine bessere Abheilung von Wunden, sowie einen positiven Einfluss auf Algenvernichtng haben. :roll:
"haben könnte"
Bernd, möchtest Du eine Erfahrungssammlung und Diskussion wie eingangs erwähnt oder suchst Du nur eine Bestätigung deiner vorgefassten Meinung?
Fadenalgen zeigten sich bei mir definitv unbeeindruckt. Vielleicht sind sie sogar besser gewachsen? :stille:
Armin und ich konnten nichts Positives feststellen und wir sind uns selten einig. :lol:
Gruß,
Frank

2.3.3.1. Probiotika
Unter dem Begriff Probiotika versteht man lebende mikrobielle Zusatzstoffe, die eine
positive Wirkung auf das Wirtstier haben, indem sie die Darmflora des Tieres günstig
beeinflussen (Fuller, 1992). Im Gegensatz zu den Antibiotika, sind Probiotika keine
mikrobiellen Stoffwechselprodukte, sondern Mikroorganismen, die aufgrund ihrer
besonderen Eigenschaften bioregulativ in die Besiedlung des Verdauungstrakts
eingreifen (Gedek, 1993, 1994). Zurzeit werden in der Tierernährung
Milchsäurebakterien der Gattungen Lactobacillus, Bifidobacterius und Enterococcus,
Sporen der Gattung Bacillus und Hefen eingesetzt. Im Augenblick sind 25
mikrobiologische Produkte zugelassen, deren Einsatz durch die EU-Richtlinie
70/524/EEC über Zusatzstoffe in der Tierernährung geregelt wird.
Die Wirkungsweise von Probiotika beruht auf einer Keimkonkurrenz zu
unerwünschten Bakterienstämmen, indem erwünschte Keime der Darmflora
gefördert und unerwünschte gehemmt werden. Dies geschieht durch die Besiedlung
der Darmwand und Bildung eines „Biofilms“ (Gedek, 1993), welcher das Anheften,
Literaturübersicht
34
Eindringen und Vermehren von pathogenen Keimen verhindern soll. Durch die
Abgabe bestimmter antibakteriell wirkender Stoffwechselprodukte (Milchsäure,
Fettsäuren, Enzyme, etc.) können probiotische Mikroorganismen einen
antagonistischen Effekt auf die Vermehrung anderer Keime ausüben (Fuller und
Gibbson, 1997). Probiotika verursachen auch eine Immunstimulation (Fuller, 1989;
Roth, 1997), so steigt beim Einsatz von Bacillus cereus der IgA- Antikörpergehalt im
Chymus um das Vierfache (Roth, 1997). Mit Lactobacillus rhamnosus gefütterte
Forellen zeigten nach 30 Tagen signifikant höhere Serumlysozym- Aktivitäten und
eine erhöhte Phagozytoseaktivität von Leukozyten. Die Anzahl der Probionten stieg
im Versuchzeitraum im Darm, aber nicht im Magen der Tiere an (Panigrahi et al.,
2004).
Untersuchungen bei Kälbern und Ferkeln zeigten eine darmflorastabilisierende
Wirkung und eine deutlich Senkung der Durchfallrate (Gedek, 1990; Zani et al.,
1998).
Die Höhe der Effekte von Probiotika gestaltet sich sehr variabel. In verschiedenen
Versuchen konnten im Schnitt 3%-6% mehr Gewichtszunahme bei Ferkeln erzielt
werden (Freitag et al., 1999). Jedoch sind die Schwankungen der Einzelversuche
sehr gross und reichen von Leistungssteigerungen von +24% bis hin zu negativen
ergotropen Effekten. Besonders in ungünstigen Situationen, wie bei Stress durch
Futterwechsel oder Umgruppierungen bei Jungtieren helfen die zugeführten
Mikroorganismen die Darmflora zu stabilisieren (Fuller, 1989; Roth, 1997).