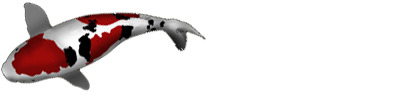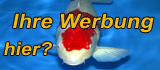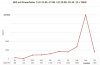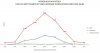A)
„Die Gesamtkeimzahl interessiert mich schon seit vielen Jahrzehnten und ich habe vor allem im Zierfischgrosshandel immer wieder Keimzahlen bestimmt.“
B)
„Ich schreibe Ihnen nun ganz ehrlich, dass ich mich mit diesem Thema schon sehr lange nicht mehr befasst hab. Ist mir einfach zu viel Theorie und zu weit weg von der Praxis Vorort.
Als ich hauptberuflich in die Koi-Gesundheit einstieg, gab ich so manche Wasseranalyse zur Auswertung an Labore. Die Ergebnisse waren stets etwas anders, als ich sie erwartet hatte. Teils so verwirrend, dass ich mir nicht nur einmal den Spaß erlaubte, identische Probeentnahmen an zwei unterschiedliche Labore zu senden und prompt erhielt ich total unterschiedliche Ergebnisse. Seit dieser Zeit verzichte ich auf Wasseranalysen zur Keimbestimmung und Keimzahlermittlung. Ich arbeite mit Labors nur noch bezüglich Antibiogrammen und KHV-Tests zusammen.“
Hallo zusammen
Diese Aussagen stammen aus E-Mails, die vergangenen Dezember, respektive Januar dieses Jahres an mich gelangten. Zitate von zwei sehr bekannten Fisch- oder eben Koispezialisten, die beide jährlich an weit über tausend Teichen im Einsatz sind und deren Ansichten über Keimzahlbestimmungen am Teich, unterschiedlicher nicht sein könnten. Während aus dem Satz von Spezialist A Begeisterung zu erkennen ist, mag sich diese bei B durch seine gemachten Erfahrungen nicht wirklich entwickeln. Auch wenn mir A mit seiner Ansicht mehr Freude bereitet, finde ich das Statement von B doch sehr interessant und auch etwas aufklärungsbedürftig. Vergleichsproben zur quantitativen Bestimmung (Ermittlung einer Zahl) mikrobiologischer Proben sind mit einer grossen Messunsicherheit behaftet. Bakterien sind in einer Probe nie gleichmässig verteilt und müssen daher immer sehr gut durchmischt werden. Vergleiche sollten auch immer aus einer gefassten Probe stammen. Zwei Proben, in zwei Gefässen gleichzeitig und an gleicher Stelle gefasst, sind zwei verschiedene Proben und nie identisch. Es ist möglich sehr ähnliche Resultate zu erhalten, man darf sich aber auch nicht wundern wenn die Differenzen extrem erscheinen. Verdünnungs- oder Pipettierfehler, Abweichung der Nährbodenrezeptur, unterschiedliche Menge an Nahrung durch die Schichtdicke des eingegossenen Flüssig-Agars in die Petrischale, Luftkeime die sich absetzen können, Bebrütungsbedingungen oder ein individueller Ablesefehler des Laboranten sind nur einige Faktoren die Vergleichsproben zur Herausforderung machen. Wenn zum Beispiel im Bereich Lebensmittel, Toleranz und Grenzwerte festgelegt werden, geschieht dies über die Resultate von vielen untersuchten Proben eines Produktes, bei denen mit komplizierten Berechnungen von Richtigkeit und Präzision, die Annäherung an den wahren Wert gesucht wird. Labors die bestimmte Normen erfüllen müssen, sind verpflichte an sogenannten Ringtests teil zu nehmen. Das heisst, dass ein Referenzlabor eine behandelte Probe mit Auftrag und einer gesetzten Keimzahl an verschiedene Analytikbetriebe versendet, worauf diese gleichzeitig und unter gleichen Bedingungen untersucht werden müssen. Dies kann sogar Europaweit geschehen. Bei der Auswertung, die durch das Referenzlabor erfolgt, gibt es verschiedene Qualitätsstufen. Nimmt man die Stufe „gute Laborpraxis“ kann man das ermittelte Resultat in etwa, mit der Zahl 3.15 multiplizieren oder dividieren und erhält so den tolerierten Höchst- oder Tiefstwert. Würde ich nun das Wasser meines Teiches, mit der Belastung von 4‘000 KBE/ml zum Vergleich geben, wären also Werte von ca.1‘300 bis ca. 12‘000 tolerierbar. Ich kenne die Vergleichsresultate von Spezialist B nicht und womöglich gab es dort auch echte Differenzen. Wenn aber nicht optimal orientierte Personen, bei meinem aufgeführten Beispiel von unterschiedlichen Resultaten sprechen, ist dies doch irgendwie verständlich. Das ist jedoch Mikrobiologie und die Interpretation von solchen Resultaten ist nicht immer leicht. Wenn nun die GKZ im Teich ermittelt wird, werden keine Vergleiche gemacht sondern viele Daten gesammelt, die schlussendlich auch aufzeigen ob sich mögliche Ausreisser eingeschlichen haben die dann dementsprechend ausgewertet oder gestrichen werden. Durch meine umfangreiche Sammlung an Resultaten der Gesamtkeimzahl in meinem Teich, ist es mir nun möglich einen ungewöhnlichen Anstieg des Keimdruckes im Wasser rechtzeitig zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren. Diese Tatsache finde ich gar nicht so übel und eine äusserst sinnvolle Aufgabe an unseren "stark" besetzten Koi-Teichen.
Gruss Dany