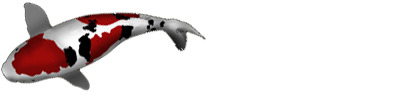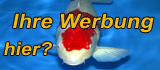Puh, alle 27 Seiten durchgelesen. Dänu, ich konnte hier vieles gutes lesen , aber musste aus Sicht eines EMA Anwenders auch einiges überdenken.
Erstmal ein Lob für deine Arbeit und deiner Motivation, hier meist als Einzelkämper durch zu halten und an dem Thema dran zu bleiben.
Leider geht es hier im Thread oft um die Keimbeseitigung mittels UVC.
Dir ist der TSEMA Thread oder auch der Thread mit der permanenten Zugabe von Microorganismen nicht unbekannt.
Ich glaube hier muss im Forum, noch einiges überdacht werden. Deine Messungen gehen absolut in die richtige Richtung, die auch den EMA oder TSEMA Anwendern wichtig sein sollten.
Bei der Anwendung der Keimreduzierung durch technische Hilfsmittel wie der UVC Lampe gibt es oft Streitereien mit den EMA oder TSEMA Anwendern.
Ist ja auch logisch. Der eine meint, man muss alle Krankheitserreger durch UVC eleminieren, der andere sagt, es geht auch mit einer Mischung aus Bakterien.
Eine weiter Fraktion ist sich sicher Krankheitserreger und Chemikalien durch Gesteine zu entfernen. Ich glaube fast, alle haben Recht.
Ich glaube, hier haben wir für die Zukunft ein großes Thema vor der Brust um Keimreduzierung, Keimvermehrung oder auch eleminierung der Schädlichen Bakterien und Chemikalien zu erforschen.
Ich persönlich habe hier eine ähnliche Aussenseiter Position wie Elvira, weil ich meine, das man durch Effektive Microorganismen und Gesteine viele giftige Stoffe aus dem Wasser elemenierne kann.
Evtl. kannst Du mir dabei helfen und mir einen Tipp geben, wie ich z.B. 6 Monate alte Zeolith oder auch andere Gesteine auf Ihre eingesammelten Chemikalien, so wie schädliche Bakterien untersuchen kann.
Gruß Alois